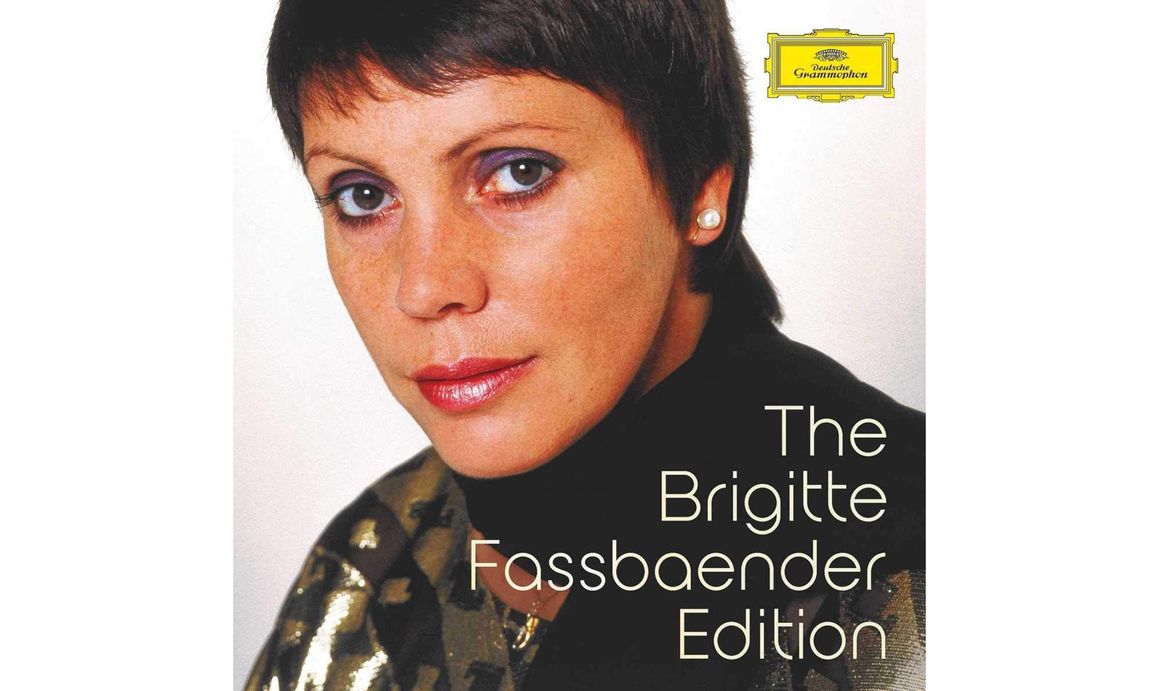In Wien erinnert man sich vielleicht noch an die erste Staatsopernpremiere mit der an der Bayerischen Staatsoper groß gewordenen Künstlerin: Mussorgskys „Boris Godunow“ in der Regie Otto Schenks. Fassbaender sang die Marina. Auf Russisch. Sie empfand es, wie sie im Interview damals gestand, als eine Art Vorhölle, weil sie, der Sprache nicht mächtig, für sie sinnlose Silben zu memorieren und über die Musik wieder mit dem rechten Sinn zu füllen hatte.
Das Publikum liebte die Fassbaender vom ersten Augenblick an, liebte, wie sie Wladimir Atlantow als falsche Schlange mit Sirenentönen umgarnte. Niemand bemerkte dank ihrer eminenten Professionalität, was ihr damals fehlte: die unvermittelte Verwandlung von Sprache in Musik. Die völlige Verschmelzung dieser Elemente wurde ab den späten Siebzigerjahren zum Markenzeichen der Lied-Sängerin Fassbaender.
Und sie verband sich in der Oper mit natürlicher Bühnenpräsenz und darstellerischer Gestaltungskunst. Je filigraner die Vernetzung von Wort und Ton, desto selbstverständlicher. Die Verquickung musikalischer Details und sprachlicher Nuancen bei Strauss und Hofmannsthal realisierte Brigitte Fassbaender in quasi improvisatorischer Selbstverständlichkeit. So wurde sie zum Rosenkavalier schlechthin, zwei Jahrzehnte konnte keine Konkurrentin ihrem Octavian Paroli bieten.
Die Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt, das war die Kür einer Künstlerin, der die Hosenrollen zur zweiten Natur geworden zu sein schienen, eingeübt bei Mozarts Cherubin, den die Fassbaender dem verehrten Karl Böhm zuliebe in München noch sang, als sie die Partie längst zurückgelegt hatte – eingebunden in eine Sängerbesetzung, die heute noch für leuchtende Augen bei Opernfreunden sorgt, Fischer-Dieskau als Graf, Walter Berry als Figaro . . .
Überhaupt die Hosenrollen, der Hänsel, der Orlofsky – „Fledermaus“ wie „Rosenkavalier“ standen in Fassbaenders Münchner Zeit übrigens in Otto Schenks Regie unter der Leitung von Carlos Kleiber; kaum je durfte sich im Nationaltheater ein anderer Dirigent über diese Stücke wagen.
Kleiber holte Fassbaender auch ins Studio, als er mit der Staatskapelle Dresden seine legendäre „Tristan“-Aufnahme gestaltete. Von den Querelen, die zuletzt zur Entzweiung mit seiner Plattenfirma führen sollten, hatten die Sänger gar nichts mitbekommen. In der Zusammenarbeit mit „seinen“ Sängern war Kleiber der liebenswerteste Maestro von allen. Und für die Fassbaender wohl der wichtigste; neben Böhm, mit dem sie in Salzburg und Wien „Così fan tutte“ erarbeiten durfte, immer an der Seite von Gundula Janowitz, mit der sie ein Traumpaar bildete.
Auf DVD kann man die Münchner „Fledermaus“ und den „Rosenkavalier“ ebenso noch erleben wie die Salzburger „Così“ auf CD. Doch die medialen Dokumente von Fassbaenders Kunst reichen viel weiter zurück. TV-Kameras waren zugegen, als sie im Prinzregententheater die Olga an der Seite Fritz Wunderlichs in „Eugen Onegin“ singen durfte – natürlich auf Deutsch. Wer diese Aufnahme hört, weiß, was mit der erwähnten Ausdrucksharmonie von Text und Musik gemeint ist, Originalsprache hin oder her.
Für die Tochter eines Sängers und einer Schauspielerin war diese Harmonie stets das höchste Ziel. Wie oft sie es erreicht hat, kann ermessen, wer die Aufnahmen hört, die die Deutsche Grammophon nun auf elf CDs vorlegt: feinnervige Lied-Gestaltungen, nicht zuletzt Schubert mit Aribert Reiman, dem analytischen Komponisten-Pianisten. Fragmente aus dem „Troubadour“, in denen sie unter Giulinis Führung italienisches Terrain erobert. Mahler unter Chailly. Und, ja, Mussorgskys „Lieder und Tänze des Todes“ – Russisch gesungen, versteht sich, und doch von jener beredten Eindringlichkeit, die den Hörer nie ahnen lassen, wie viel „Übersetzungsarbeit“ in jedem Sinn des Wortes die Sängerin darauf verwendet haben muss, um aus höchster artifizieller Beherrschung wieder Natürlichkeit werden zu lassen.